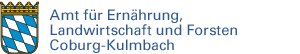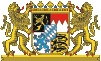Demoversuch zum gewässerschonenden Maisanbau
Gute Erträge und fruchtbarer Boden
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
© Ulf Felgenhauer / AELF CK
Die Grundlage des Ackerbaus ist ein fruchtbarer Boden. Er verbessert die Nährstoffverwertung und reduziert die Bodenerosion. Um Landwirten zu zeigen, wie man Mais mit geringem Einsatz von Düngemitteln und erosionsmindernden Bodenbearbeitungsverfahren umweltschonend anbauen kann, macht das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Coburg-Kulmbach regelmäßig Feldversuche zum gewässerschonenden Maisanbau. Auf dem Gewässerdemonstrationsbetrieb von Hubertus von Künsberg aus dem Küpser Ortsteil Schmölz (Landkreis Kronach) wurde heuer so ein Versuch angelegt.
Mais bietet viele Vorteile
Was Düngeeffizienz und Pflanzenschutzaufwand betrifft, ist Mais eine beinahe unschlagbare Kultur. Verglichen mit anderen Getreide- oder Futterbaukulturen braucht er am wenigsten Dünger bezogen auf die in der Praxis erzielbaren Erträge. Mais bringt doppelt so viel Ertrag wie Grünland, selbst wenn dieses viermal im Jahr geschnitten wird. Außerdem muss Mais nur ein einziges Mal mit einem Herbizid gegen Unkräuter behandelt werden. Aufgrund dieser Vorteile ist er die Futterkultur schlechthin für Rinderhalter und die effizienteste Kultur für Betreiber von Biogasanlagen.
Ein Blätterdach reduziert die Aufprallenergie von Niederschlägen
Der Maisanbau macht aber auch Probleme. Dazu gehört in erster Linie die höhere Gefahr von Bodenerosion: Nach der Saat ist eine Anschwemmung von Boden häufiger als bei anderen Kulturen zu beobachten. Das liegt auch daran, dass Mais erst Ende April bis Anfang Mai gesät wird, wo die Niederschläge im Regelfall stark ausfallen. Hangneigung und feiner Boden erhöhen die Erosionsgefahr zusätzlich. Dazu kommt, dass Mais nur mit neun bis zehn Pflanzen pro Quadratmeter gesät wird, weshalb der Boden lange unbedeckt bleibt und stark für Bodenabtrag gefährdet ist. Die Gefahr sinkt erst, wenn die Blätter so groß sind, dass sie ein „geschlossenes Blätterdach“ bilden. Dann sinkt die Erosionsgefahr gegen null, da die Blätter die Aufprallenergie des Regens abmildern.
Vergleich verschiedener Anbausysteme
Im Versuch in Schmölz hat Initiator Fritz Asen, Pflanzenbauberater am AELF Coburg-Kulmbach, getestet, welche Bodenbearbeitung am geeignetsten ist, den Bodenabtrag aus Maisfeldern zu reduzieren. So wurde beispielsweise die Bodenbearbeitung mit Pflug mit dem sogenannten pfluglosen Anbauverfahren verglichen, bei dem unter anderem Grubber, Kreiselegge und Fräse zum Einsatz kamen. Pfluglose Bodenbearbeitungssysteme gelten als erosionsmindernd. Zudem wurde geprüft, wie weit man den Düngeraufwand zu Mais reduzieren kann, bei trotzdem zufriedenstellenden Erträgen. Weitere Tests gab es zu unterschiedlichen Düngetechniken und Düngeterminen. Dabei wurde modernste Landtechnik eingesetzt, beispielsweise ein Gülletrac, der in einem einzigen Arbeitsgang den organischen Dünger mit dem angebauten Grubber sofort einarbeitet und dem Boden vermischt. Dies reduziert den Verlust von Stickstoff, der ohne Einarbeitung schnell in die Luft abgasen würde und dann für die Pflanzen verloren ist.
Wichtige Erkenntnisse für die landwirtschaftliche Praxis
Der Versuch zeigt, dass man auch mit pfluglosen Anbausystemen Mais erfolgreich anbauen und damit die Bodenerosion deutlich reduzieren kann. Zwischen den unterschiedlichen Anbauverfahren war kein Unterschied im Sommer in der Maisentwicklung zu beobachten. Eine weitere Erkenntnis ist, dass man auch mit einer reduzierten Düngermenge gute Erträge erzielen kann. In diesem Versuch zeigte auch eine sehr stark reduzierte Düngung keinerlei negative Ertragsmengen. Die Ursache dafür ist, dass aufgrund der langjährigen bodenschonenden und fruchtbarkeitsfördernden Bewirtschaftung durch den Betriebsleiter, der Boden in einem sehr guten Zustand war. Gefördert wird die Bodenfruchtbarkeit beispielsweise durch den Anbau von Zwischenfrüchten wie Senf, den man derzeit an den gelb blühenden Feldern erkennt. Die Erkenntnisse werden der landwirtschaftlichen Praxis an die Hand gegeben.
Wie bewertet man einen Ackerboden?
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
© Ulf Felgenhauer / AELF CK
Pflanzenbauberater Michael Funk, ebenfalls vom AELF Coburg-Kulmbach, zeigte mithilfe des sogenannten Bodenkoffers, wie man die Bodenfruchtbarkeit bewerten kann. Kriterien sind beispielsweise die Anzahl von Regenwurmlöchern oder -gängen in einer Bodenprobe. Außerdem bewertet man Kalkgehalt und Krümelbildung, also wie locker ein Boden ist. Je lockerer, desto leichter und tiefer können die Pflanzenwurzeln im Boden wachsen.